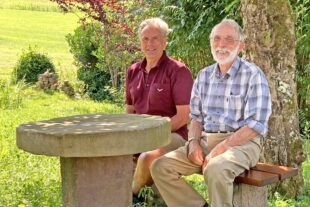Als städtischer Sozialarbeiter betreut Albert Heizmann Migranten, ukrainische Kriegsflüchtlinge und Obdachlose – ganz wichtig: Beziehungsarbeit. Und die fühlt sich in der Vorweihnachtszeit anders an.
„Ich betreibe „aufsuchende Arbeit“, erklärt Albert Heizmann, „das heißt, ich lasse die Leute nicht zu mir kommen, sondern ich komme zu ihnen.“ Mehr als 20 Jahre lang war der studierte Sozialarbeiter in der städtischen Jugendhilfe tätig. Seit fünf Jahren nun betreut er in Zell – je nach individueller Notwendigkeit – über 50 Migranten, vor allem Syrer und Afghanen, teilweise auch Türken, und seit Beginn des Ukraine-Krieges, die von dort Geflüchteten. Hinzu kommen rund 30 Russlanddeutsche sowie über zehn Obdachlose.
„Wenn man zu Migranten geht, muss man immer erst mal gucken, was man tut, wie man sich verhält, weil sie ja aus einem ganz anderen Kulturkreis kommen.“ Das beginnt mit dem Ausziehen der Schuhe, wenn man zur Tür hereinkommt. „Aus Respekt mache ich das immer, aber andere trampeln da oftmals einfach rein.“ Auch kann man Frauen nicht mit Handschlag begrüßen. „Für solche Dinge muss man ein „feeling“ entwickeln – am Anfang hat man das vielleicht noch nicht so ganz“, erzählt der in Unterentersbach Geborene und Wohnende.
Wichtig ist ihm auch, die jeweilige Sprache zumindest ein bisschen zu lernen – arabisch, syrisch, russisch. Vor allem möchte er sich in der Muttersprache der von ihm betreuten Migranten bedanken können, „denn die sind immer sehr höflich und gastfreundlich“, das Servieren von Kaffee oder Tee gehört grundsätzlich dazu.
„Abholen“
Ansonsten läuft die Verständigung in Englisch. Dort, wo das nicht klappt, hilft zumindest beim Wichtigsten das Handy, sprich die Übersetzung per Google. Wobei Albert Heizmanns Aufgabe darin besteht, die Migranten in der Situation „abzuholen“, in der sie sich gerade befinden. Und zwar dann, wenn sie aus ihrer Flüchtlingsunterkunft heraus und in eine ihnen von der Stadt zugewiesene Wohnung kommen. „Da heißt es für mich: Das ist ihr Reich – was gilt hier, was müssen sie beachten?“ Der 65-Jährige erklärt seinen Schützlingen, was erledigt werden muss, verweist an die zuständigen Stellen. Insbesondere über anstehende Sozialleistungen wird gesprochen, und darüber, ob, wie und wo Anträge zu stellen sind. In dringenden Fällen kümmert er sich auch selbst um die Anträge.
„Dabei versuche ich mit ihnen ein Stück weit eine Beziehung aufzubauen“, betont der inzwischen in Teilzeit arbeitende Rentner. Das Wichtigste dabei: Empathie und Offenheit. Um herauszufinden, wie es dem Gegenüber gerade geht, was er braucht, wie die Bedürfnisse sind. „Ganz schwierig ist es vor allem für junge Migranten, hier bei uns Bürokratiekram zu erledigen“, weiß er nur zu gut, „ältere Leute oder solche, die schon länger in Deutschland sind, haben das ein bisschen besser drauf.“ Das fängt bei der Frage an, ob der Betreffende von Rundfunkgebühren befreit werden kann. „Auch versuche ich, die Leute in Arbeit zu bringen oder dabei mitzuhelfen, indem ich ihnen beispielsweise Termine bei Anlaufstellen mache, von wo aus es dann für sie weitergeht.“
Berührungsängste: „Das geht gar nicht!“
Das A und O sei, dass man in den Austausch miteinander komme. Keinesfalls dürfe man daher bei dieser Arbeit Berührungsängste haben, so Albert Heizmann – keine Angst davor, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, oder bestimmte Dinge zu fragen, „das geht gar nicht!“
bgesehen davon seien die Migranten sehr offen. „Unbedingt wichtig ist einfach, dass sie Vertrauen gewinnen, dass sie erzählen können, denn das hilft ihnen weiter.“ Was umso bedeutsamer ist, als die Migranten in der Regel traumatisiert sind. Bei Familien wiederum betrachtet er die Beziehungsarbeit als essentiell, „weil sie sehr viele Bedürfnisse haben, was ihre Kinder anbelangt – dass die gescheit versorgt sind, da schaue ich drauf.“
Bei den Ukrainern – sie sind ins Haus der Begegnung eingezogen – war erschwerend, dass es sich nicht nur um jüngere Menschen oder Mütter mit Kindern handelte, sondern gerade in der Anfangszeit auch um Ältere über 60 Jahre, „wo die Bedürfnisse einfach andere sind.“ Diese hatte Albert Heizmann anfangs sehr oft besucht. Keine Zeit jedoch hatte er dazu, „das dann noch weiter zu öffnen, ins Gemeinwesen rein, um noch mehr Kontakte zu knüpfen.“ Dennoch begleitete er manchmal jemanden zum Spiele-Nachmittag, damit dort Kontakte geknüpft werden konnten. Und Kinder versucht er an einen Verein „anzudocken“. Das aber ist stets der zweite Schritt. Der erste besteht darin, „sie ankommen zu lassen und zu gucken, wo stehen sie und auch zu gucken, wie können sie sich im Gemeinwesen orientieren.“ Bei den Älteren kommt in der Regel die Notwendigkeit ärztlicher Betreuung hinzu.
Das A und O: Empathie und Offenheit
Ein für Albert Heizmann ebenfalls „ganz wichtiges Klientel“ stellen die Obdachlosen. dar: Arbeitslose, die beispielsweise eine Zwangsräumung hinter sich haben. „Die stehen normalerweise auf der Straße, werden von der Stadt aber sozusagen „eingewiesen“, in eine Wohnung. Eine solche Zwangsräumung komme immer mal wieder vor. „Das trifft dann immer hart, denn die Leute (sowohl Einzelpersonen als auch Familien) verlieren im Prinzip alles, sie können nichts mitnehmen.“ Eine Zeitlang wird ihr noch vorhandenes Hab und Gut eingelagert, dann aber muss es weg. „Diese Leute werden sozusagen auf null gestellt, das ist richtig krass.“ Entsprechend stark sei die psychische Anspannung dieser Menschen, die er miterleben müsse, beschreibt der Sozialarbeiter, „da geht es dann manchmal auch zur Sache – dann werden die Leute aus der Verzweiflung heraus aggressiv.“
Er schaut darauf, dass sie Bürgergeld beantragt haben und versucht zu helfen, dass sie wieder Anschluss ans Arbeitsleben finden. „Damit sie die Möglichkeit haben, wieder etwas zu tun.“ Dankbarkeit für sein Tun erfährt Albert Heizmann nicht unbedingt, meist halte sich dies sehr in Grenzen oder sei zumindest nicht „sichtbar“, werde stattdessen anders gezeigt.
Anders verhält es sich vor allem bei den Ukrainern: „Wenn die mich auf der Straße sehen, dann freuen sie sich richtig und strahlen über das ganze Gesicht und wir schwätzen ein bisschen miteinander, zur Not mit Händen und Füßen. Das ist das Schöne daran, wenn auf diese Weise etwas zurück kommt: An diesem Zwischenmenschlichen merkt man, was man gearbeitet hat, das macht mir Freude.“
Vorweihnachtszeit – Ausnahmezeit
Stets gilt es für Albert Heizmann bei seiner aufsuchenden Arbeit abzuwägen zwischen dem, was er den Leuten in ihrer jeweiligen Situation zumuten kann und was nicht. „Und da bin ich wirklich nicht zimperlich“, betont er, „ich bin nicht nur derjenige, der lieb ist, sondern einer, der auch mal fordert.“
Als diesbezüglich eine Art Ausnahmefall allerdings betrachtet er die Vorweihnachtszeit, die auch für ihn persönlich etwas Besonderes ist. Den Austausch mit seinen Schützlingen empfindet er in dieser Zeit als sensibler. „Man merkt, dass die Menschen ein bisschen anders ticken.“ Genau beschreiben könne er das nicht. Es sei so, als ob in dieser Zeit wie ein Nebel noch etwas anderes mitschwinge, auch in vom Islam geprägtem Umfeld.
„In der Vorweihnachtszeit erlebe ich die Menschen ein bisschen anders“, Migranten, Ukrainer und Obdachlose gleichermaßen. Vielleicht gehe es in diese Richtung, versucht sich der Sozialarbeiter an einer Erklärung: „Das Jahr neigt sich jetzt dem Ende zu, verlang´ doch bitte nicht mehr so viel, lass uns doch ein bisschen besinnlicher werden“, lächelt Albert Heizmann in dem Versuch, etwas nicht konkret Fassbares zu beschreiben, „das ist eher eine Intuition, die ich spüre, was so aber nicht wirklich von den Leuten ausgedrückt wird.“ Mit dem Ergebnis, dass er seine Schützlinge vor Weihnachten lediglich besuche und sonst nichts weiter mit ihnen mache, „wenn ich merke, das ist ihnen eben einfach zu viel.“
Umso schöner ist es für ihn, Freude verbreiten zu können: Nicht mehr benötigte Spielsachen oder sonstige Dinge, die ihm geschenkt respektive gespendet worden sind, verteilt er um Weihnachten herum an alle Migrationskinder.
Wie er selbst das Weih nachtsfest feiert? „Mit meiner großen Familie“, lacht er sein so erstaunlich unbeschwert klingenden Lachen, zum einen ist er zweifacher Opa, zum anderen hat seine Frau sechs Geschwister. Neben gutem Essen gehört auch das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern dazu. Überhaupt singt er selbst im Chor und spielt Gitarre – angesichts der Anforderungen, die sein Beruf mit sich bringt, ist ihm die Musik unentbehrlich für seine „psychische Hygiene“, wie er es nennt. Dieser dient auch der Austausch mit seinen Arbeitskolleginnen von der Stadt, „durch den geben wir uns gegenseitig Kraft.“
Infos
Während im Islam das Ende des Ramadams und das Opferfest die beiden zentralen religiösen Feste sind, ist für Christen Weihnachten eines der bedeutendsten religiösen Feste im Jahr.
Das ukrainische Weihnachtsfest wurde von orthodoxen Christen bislang nach dem julianischen Kalender gefeiert, in dem der 24. und 25. Dezember auf den 6. und 7. Januar fallen. 2023 jedoch beschloss die Orthodoxe Kirche der Ukraine, für feste Feiertage (außer Ostern) auf den gregorianischen Kalender umzustellen, so dass nun der 25. Dezember der Termin für die Weihnachtsfeier der ukrainischen Orthodoxen sein wird. Dies wurde daraufhin vom ukrainischen Parlament mit einem Gesetz untermauert, das den julianischen Feiertag am 07. Januar abschafft.
Im Zuge dieser Umstellung wollen heuer rund 45 Prozent und damit die Mehrheit der Ukrainer Weihnachten am 25. Dezember feiern, 17 Prozent weiterhin am 07. Januar. 32 Prozent planen zweimal zu feiern. So besagt es eine Studie, die im November 2023 von dem internationalen Unternehmen Deloitte durchgeführt wurde.
Übrigens: Ukrainer, denen nicht Weihnachtsmann oder Christkind, sondern „Väterchen Frost“ Geschenke bringt, schmücken ihren Weihnachtsbaum gerne mit einem Netz und auch einer Spinne. Dieser Brauch, der Glück bringen soll, geht auf eine Legende zurück. Der zufolge besaß eine arme alte Frau kein Geld für das Schmücken ihres Weihnachtsbaums. Am nächsten Tag hatte eine Spinne den Baum mit einem glitzernden Netz bedeckt.