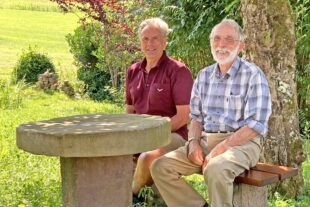Franz Joseph Buß wurde am 23. März 1803 als Sohn des gleichnamigen Bürgermeisters und Barbara Buß geb. Jäkle geboren. Bei der noch am selben Tag erfolgten Taufe standen Jacobus Winterhalter und Francisca Sohler Pate. Winterhalter und der Mann von Frau Sohler amtierten als »Stättmeister«. Dieser Titel stammt noch aus der Reichsstadtzeit, die 1803 allerdings abgelaufen war. 1806 erhielt Vater Buß den Titel »Oberbürgermeister«, um sich von den Nachbargemeinden, die nach 1803 selbständig wurden und »Bürgermeister« bekamen, abzuheben.

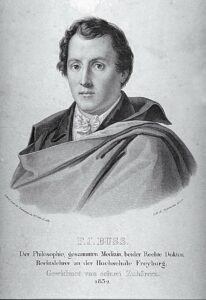 Foto: Archivfotos: Dieter Petri
Foto: Archivfotos: Dieter Petri
Von Beruf war der Vater Franz Joseph Buß Schneider. Zu seinen beruflichen Aufgaben gehörte auch die Stör, bei der ein Schneider für eine Weile seine Werkstatt in der Stube eines Bauernhofes aufschlug und die schadhafte Kleidung für Alltag und Fest reparierte. Es entsprach wohl dem Wunsch des Vaters, dass der Sohn aufs Gymnasium geht. Um dort den Anschluss zu bekommen, bekam Franz Joseph Lateinstunden in Biberach, bei Pfarrer Johannes Götz, einem ehem. Benediktiner des inzwischen aufgelösten Klosters Gengenbach.
Mit den Herausforderungen des Gymnasiums in Offenburg, später nach Grimmelshausen benannt, dessen Schwerpunkt die alten Sprachen bildeten, hatte Franz Joseph keine Probleme. Als Klassenprimus durfte er am Ende der Schulzeit die Abiturienten-Rede halten. Er servierte sie in Reimen. 22 Strophen hatte sein Gedicht. Es beginnt etwas hochgestochen mit den Worten »Hinauf, hinauf zur stolzen Bahn der Sonnen/aus meiner Träume Jugendwelt«. Auch wenn der Absolvent bekennt, dass seine Jugendträume inzwischen zerronnen seien, so bleibt doch das Pathos, das den Professor und Redner Buß ein Leben lang begleiten wird.
Kaum an der Universität Freiburg angekommen, stellt er sich freiwillig einer akademischen Preisaufgabe über den griechischen Dichter Pindaros – und erhält den Zuschlag. Anstatt sich jedoch entsprechend seiner Begabung der Sprachwissenschaft zuzuwenden, beginnt er 1822 ein Studium der Medizin, um drei Jahre später das Jura-Studium aufzunehmen. Jurist wird er bleiben und es dabei zum Professor bringen.
1833 heiratet Buß die Freiburgerin Amalie Buiston. Tragischerweise stirbt sie bei der Geburt ihres ersten Kindes, das tot zur Welt kommt. Für Buß der zwischenzeitlich in Basel zum Dr. med., ausgerechnet mit dem Schwerpunkt Geburtshilfe, promoviert hatte, war dies ein schwerer Schlag, der ihn zweifellos ernster machte. Zwei Jahre später heiratet er Magdalene Geßler aus Horb.
Der elfenbeinerne Turm der Wissenschaft genügt Buß nicht, es drängt ihn zur gesellschaftlichen Gestaltung. Er kandidiert für den Badischen Landtag und wird gewählt. Zu seinem Wahlkreis gehört zwar nicht das heimatliche Zell, dafür aber dessen Nachbarorte Gengenbach und Oberkirch. Der Landtag in Karlsruhe bestand aus zwei Kammern. Die Mitglieder der Ersten Kammer wurden vom Großherzog berufen, die Abgeordneten der Zweiten Kammer von den Wahlmännern eines Wahlkreises gewählt. Die erste Rede von ihm im Parlament wird als »Fabrikrede« in die Geschichte eingehen. Buß macht auf die sozialen Probleme der Industrialisierung aufmerksam und nimmt bei seinen Vorschlägen den Staat in die Pflicht.
Dass Buß konservativ gestimmt war, zeigt seine Anhänglichkeit an die Monarchie. Die 48er-Revolution lehnte er ab, weil ihre radikalen Vertreter, die Herrschaft der Fürsten ganz abschaffen wollen. Bei seinem Aufruf zur Gegenrevolution hat er die einem Staatsbeamten auferlegte politische Zurückhaltung missachtet und dadurch seine Entlassung riskiert. Er behielt jedoch den gesicherten Status und wurde in die Frankfurter Nationalversammlung gewählt. Dass dabei sein Wahlkreis Ahaus am Niederrhein lag, beweist seine inzwischen eingetretene deutschland weite Popularität.
In der Frankfurter Paulskirche kämpfte Buß für eine Wiedervereinigung von Österreich und Deutschland unter österreichischer Kaiserkrone – vergeblich. Doch hat das österreichische Kaiserhaus 15 Jahre später das Engagement mit der Erhebung in den Adelsstand honoriert. Kaiser der Deutschen wurde schließlich der preußische König Wilhelm I. Bismarck hat ihn 1871 am Ende des Feldzuges gegen Frankreich in Versailles als solchen ausgerufen. Buß machte seinen Frieden mit den neuen Verhältnissen und ließ sich 1874 als Abgeordneter in den Berliner Reichstag wählen.
Der Wahlkreis Tauberbischofsheim hatte ihn gewählt. Sein Mandat endete 1877.
Im Januar des folgenden Jahres 1878 ist Ritter von Buß auf dem Weg zur Universität zusammengebrochen. Er hatte seine Vorlesung, in ahnungsvoller Weise über das Friedhofsrecht, fortsetzen wollen. Bestattet wurde er auf dem Freiburger Hauptfriedhof.