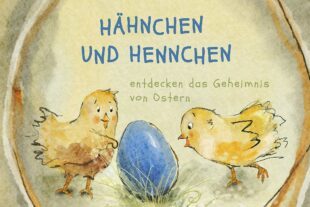Immer wieder bedrohen Seuchen die Gesundheit der Menschen. Da die Ansteckung unbemerkt erfolgt und sich die Erkrankung erst nach einer Inkubationszeit zeigt, entsteht eine große Verunsicherung. Um die massenweise Ausbreitung eines Virus zu vermeiden, war und ist die politische Verwaltung gefordert. Einschränkungen der Kontaktfreiheit überzeugen heute und überzeugten früher nicht jeden Bürger. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bedrohten hierzulande die »Blattern« oder »Pocken« die Gesundheit der Menschen. Ein Blick in die Zeller Geschichte zeigt, wie die Bürger und die Stadtverwaltung damals damit umgingen.
Im Dezember 1870 trat in Zell bei einer Frau Kromer die Infektionskrankheit »Blattern« oder »Pocken« auf. Das Bezirksamt Gengenbach erinnert die Stadtverwaltung an die für diesen Fall vorgesehenen gesetzlichen Maßnahmen. Sie waren 1865 vom Badischen Innen-Ministerium erlassen worden. Dazu gehörte auch eine Warntafel, die am Haus des Erkrankten anzubringen ist. Sie sollte die Öffentlichkeit auf die Infektionsgefahr hinweisen.
Das Bürgermeisteramt musste den Ausbruch der Krankheit durch den Stadtboten ausschellen lassen. Dabei waren auch die Anzeichen und Merkmale der Krankheit bekannt zu machen, nämlich mehrtägiges Unwohlsein oft verbunden mit Kopfschmerzen, Halsweh, Fieber, Schüttelfrost und Gliederreißen. Im Gesicht und am übrigen Körper zeigen sich kleine rote Flecken. Diese weiten sich zu Bläschen aus, die sich mit Flüssigkeit füllen.
Mittel zur Desinfektion
Der zweite Fall, der dem Bezirksamt gemeldet wird betrifft Sigmund Moser. Er arbeitet in der oberen Porzellan- u. Steingutfabrik. Fabrikant Gottfried Lenz wird informiert und angewiesen, in seinem Betrieb verstärkt auf die Hygiene zu achten, um eine Ausbreitung zu vermeiden. Auch der Betreiber der Unteren Keramikfabrik, Schaible, wird aufgefordert, wachsam zu sein und jede Erkrankung an Blattern sofort zu melden.
Da weitere Fälle auftreten, verlangt die Stadt: »Es mögen jeden Tag die Wohnräume mit Wachholderbeeren oder mit Carbolsäure ausgeräuchert und ausgelüftet werden.« Die öffentlichen Lokale als da sind Gastwirtschaften Geschäfte, Bäcker und Metzger müssen die Carbolsäure ständig aufgestellt haben. Die Wohnungen von Erkrankten dürfen nur von pflegenden Personen betreten werden. Wer diese Maßnahmen nicht einhält, dem drohen eine Geldstrafe von 25 bis 50 Gulden oder, wenn er diese nicht bezahlen kann, 14 Tage Gefängnis.
Ein Problem sind Pockenkranke, die allein leben und keine Angehörigen haben, die sie pflegen. Sie müssen nach Anordnung des Bezirksamtes in das örtliche »Spital« (Krankenhaus) aufgenommen werden. Dort hat man zuletzt Betten für verwundete Soldaten aus dem Siebziger Krieg gegen Frankreich Betten vorhalten müssen. Da in Zell aber kein »Staatsarzt« amtierte, wurde die Reservierung aufgehoben. Um die übrigen Bewohner des Spitals nicht zu gefährden, wurde im zweiten Stock eine eigene Station für Infizierte eingerichtet. Dazu gehörten zwei Zimmer für die Betten, ein Vorzimmer für den »Wundarztdiener« (medizinischen Helfer), der nach Anordnung der Ärzte Dr. Kirner und Dr. Dreher die Infizierten betreute, und eine eigene Küche. Die Kosten übernahm die Spitalstiftung.
Eine Frau Röckel wurde so heftig krank, dass eine Verlegung ins Spital nicht vertretbar schien. Bei ihr wohnte ein 13-jähriges Mädchen, das zur Betreuung herangezogen wurde. Die Stadt schickte den Wundarztdiener Winterhalter vorbei, der die Wohnung ausräucherte. Ferner ließ die Stadt die Verpflegung an die Haustüre stellen, wo sie von der 13-jährigen übernommen wurde. Das Mädchen durfte das Haus lediglich für die Impfung verlassen.
Der Hausbesitzer, Blechner Boos, in dessen Haus Frau Röckel mit dem Mädchen wohnte, brachte die verlangte Warntafel nicht wie vorgeschrieben am Hauseingang, sondern lediglich innerhalb des Hauses an der Wohnungstüre der Erkrankten an. Die »Gendarmerie« (Polizei) bestand auf einer Berichtigung. Bürgermeister Xaver Moßmann bat das Bezirksamt von einer Bestrafung abzusehen. Später hat der Bürgermeister bei der Erkrankung von einem Johann Harter selbst die Anbringung einer Warntafel veranlasst.
Bürgermeister als Vorreiter
Die Stadt wäre bereit gewesen, eine infizierte Marianne Breig ins Spital aufzunehmen. Da sie aber taubstumm war und sich nur ihre Schwester mit ihr verständigen konnte, sah man davon ab. Der Mann der Schwester, der in der Fabrik arbeitete, zog vorsorglich aus der Wohnung aus. Die schulpflichtigen Kinder bekamen Schulverbot.
Die Stadt meldete am 8. Februar 1871, dass nunmehr 11 Bürger an Blattern erkrankt seien. 16 Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren hätten sich bereits einer Impfung unterzogen; sowie zwei Erwachsene. Unter den beiden Erwachsenen war auch Bürgermeister Moßmann. Er war also mit gutem Beispiel vorangegangen. Am 24. März 1875 versprach das Bezirksamt beim Eintritt einer »milderen Winterung« die Kinder und alle Erwachsenen, die sich freiwillig melden, durch den »Großherzoglichen Bezirksarzt« impfen zu lassen.
Die Stadt beschloss, für Bedürftige die »Räucherungsstoffe« kostenlos abzugeben. In einem Schreiben an das Bezirksamt lamentierte sie indessen, insbesondere die Bürger aus umliegenden Ortschaften würden sich zu wenig um die Desinfektion kümmern und sich beim Einkauf in den Geschäften und beim Besuch der Kirche anstecken.
Gefahr unterm Dach
Die Pocken-Epidemie grassierte in Zell etwa ein halbes Jahr. In der Regel waren die Infizierten nach zwei Wochen wieder gesund. Schwerer erkrankten 22 namentlich genannte Personen. Eine von ihnen, Marianna Schmidt, hat die Seuche nicht überlebt. Nach ihrem Tod beschwerte sich Valentin Schmidt, der Bruder der Verstorbenen beim Bezirksamt über Bürgermeister Moßmann. Um die Beschwerde offiziell zu machen, gab der »Gold-Brenner«* der Zeller Porzellanfabrik seine Beschwerde persönlich beim Bezirksamt Gengenbach zu Protokoll. (*Das Auftragen von Goldrändern auf das Geschirr bedurfte eines eigenen Brennvorgangs.).
Marianna Schmidt hatte zusammen mit ihrer Mutter im Haus von Fabriktagelöhner Pfundstein gewohnt. Als bei der Tochter die Infektion ausbrach, wollte der Hauseigentümer die Kranke nicht mehr in seinem Haus dulden. Deshalb hat Valentin, der Bruder der Erkrankten, nach eigenen Angaben den Bürgermeister um die Aufnahme der Schwester ins Spital gebeten. Dieser habe jedoch die Bitte abgeschlagen. Der Bürgermeister hat später dieser Version heftig widersprochen. Er habe vielmehr eine Verlegung ins Spital angeordnet.
Die Mutter habe sich nämlich einer Verlegung der Tochter zuerst widersetzt, so der Bürgermeister. Die Kranke selbst sei nicht bereit gewesen, zu Fuß zum nahen gelegenen Spital zu gehen, obwohl sie gesundheitlich dazu in der Lage gewesen wäre. Daraufhin hat die Hausherrin kurzer Hand die Kranke auf einen Karren gesetzt und zum Spital gefahren. Nun bestand die Mutter darauf, die Pflege ihrer Tochter im Spital selbst übernehmen zu dürfen, was ihr zugestanden wurde. Für den Aufwand erhielt sie aus der Spitalstiftung eine Unterstützung.
Totenehre verletzt
Marianne Schmidt starb jedoch an der Pocken-Erkrankung. Sie sollte noch am selben Tag beerdigt werden. Dies hatte die Stadtverwaltung zu garantieren. Der Bruder der Verstorbenen beschwerte sich später beim Bezirksamt, dass seine Mutter dem Totengräber hatte helfen müssen, die Leiche in den Sarg zu legen. Die Stadt habe dafür keinen weiteren Helfer aufgeboten. Für das Fahren der Leiche zum Friedhof habe die Stadt einen »Dungwagen« verwendet, so ein weiterer Vorwurf. Auch dieser Behauptung widersprach der Bürgermeister. Man habe in der gebotenen Eile auf ein »Wägele« des Ziegelbrenners Walk zurückgegriffen.
Tatsächlich waren die Umstände der Beerdigung von Marianne Schmidt auch dem Bürgermeister unangenehm. Er befasste noch am selben Abend den Stadtrat mit dem Problem. Man beschloss für künftige Fälle zwei Helfer zu suchen, welche gegen eine ansehnliche Belohnung das Opfer der Epidemie bestatten würden. Zweitens wurden ein eigener Wagen und eine eigene Tragbahre für die Überführung infizierter Leichen angeschafft. Das Bezirksamt empfahl bei der Bestattung jedoch nur solche Helfer einzusetzen, die entweder selbst an den Pocken erkrankt waren und die Krankheit überwunden haben oder sich hatten impfen lassen.
Zweifel am Zweck
Ein Schreiben des Bezirksamts beklagt, dass in Zell am 2. Oktober 1871 von 25 zur Impfung einbestellten Kinder nur 9 erschienen seien. Der Bezirksarzt bat jedoch das Amt von einer vorgesehenen Bestrafung von 10 Mark je Kind abzusehen. Den Eltern der Kinder fehle es an der nötigen Einsicht, so der Arzt. Ihr Widerstand richte sich nicht gegen Obrigkeit. Das Amt bestand jedoch darauf, dass der Bürgermeister die 16 namentlich aufgeführten Väter der Kinder einbestellt und ihnen im Wiederholungsfall mit der vorgesehenen Strafe drohen.
1980 hielt die Weltgesundheitsorganisation das Pockenvirus nach einem weltweiten Impfprogramm für ausgerottet. Die allgemeine Impfpflicht wurde daher aufgehoben. (Brockhaus)
Quelle: Stadt-Archiv Zell,
Akten VIII.4.2 u.58