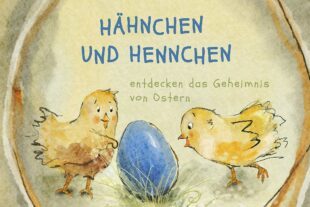»Ich kann Ihnen nicht sagen, ob Sie Ihr Kind impfen lassen sollen oder nicht«, erklärte Anna Niederberger bei der jüngsten Fortbildungsveranstaltung des DRK-Ortsvereins. Angesichts steigender Impfmüdigkeit – fünf Prozent der Eltern lassen ihre Kinder nicht impfen – macht sie jedoch auf die Gefährdung des sogenannten »Herdenschutzes« aufmerksam.
»Wer von Ihnen hat im Bekannten- oder Verwandtenkreis jemanden, der Kinderlähmung hatte und bleibende Schäden davongetragen hat?«, fragt Anna Niederberger, bevor sie mit ihrem Vortrag beginnt.
Einige der 20 Zuhörer heben die Finger. Das zeigt: Es ist noch gar nicht so lange her, dass die Poliomyelitis oder einfach Polio genannte Viruserkrankung eine schlimme Bedrohung darstellte – für meist Drei- bis Achtjährige. Erst mit der Verfügbarkeit eines Impfstoffes in den 1950er-Jahren verlor der Erreger allmählich seinen Schrecken, ältere Semester werden sich noch an die an Schulen durchgeführten Schluckimpfungen erinnern. Zumindest in Deutschland gilt die Krankheit inzwischen als ausgerottet.
»Ich habe Tagebuchaufzeichnungen meiner Mutter gelesen«, erzählt die promovierte Internistin, »die war Kinderärztin und hatte mehrere Kinder als Patienten, die an Diphterie gestorben sind.« Diphterie, das ist eine akute und quälende Erkrankung der oberen Atemwege. Auch deren Wüten hierzulande ist also noch gar nicht so lange her. Desgleichen erinnert sich die 73-Jährige an ihre eigene Keuchhusten-Erkrankung und an die ihrer Kinder: »Das war nicht lustig«, konstatiert sie trocken – sie, die aufgrund ihres Wirkens in Entwicklungsländern hierzulande kaum vorstellbares krankheitsbedingtes Leid gesehen hat.
Impfungen gibt es inzwischen gegen eine Vielzahl von viralen und bakteriellen Infektionen. Was aber bedeutet »impfen« überhaupt? Kurz gesagt: »Der Körper wird in die Lage versetzt, Krankheitskeime zu erkennen und unschädlich zu machen«, erklärt Niederberger. Das geschieht, indem durch Injektion (Spritze) oder Tropfen (Schluckimpfung) abgeschwächte oder abgetötete Keime respektive Schadstoffe in den Körper gebracht werden. Der erkennt sie als fremd beziehungsweise schädlich und entwickelt gegen diese sogenannten Antigene Abwehrstoffe, sprich Antikörper.
Die Sache mit der Kuh
Wobei das Impfen eine lange Geschichte hat. »Die basiert vor allem auf Beobachtung«, weiß die Ärztin. So beobachtete man 4000 v. Chr. in Griechenland, dass überlebende Pest-Erkrankte später nicht nochmals pestkrank wurden. »Sie mussten also irgendeinen Stoff gehabt haben, der diese Pest abgewehrt hatte.« 3000 Jahre später – in Indien und China – rieb man Gesunden pulverisierte Pocken von Patienten, die aufgrund eines leichten Verlaufs der Erkrankung überlebt hatten, in die Nasenschleimhaut. Zwecks Immunisierung.
Im 18. Jahrhundert dann stellte man fest, dass Melkerinnen, die Kuhpocken – eine milde Form der Pocken – überstanden hatten, nicht den Blattern zum Opfer fielen: der gefährlichen Pockenform. Als schließlich ein Herr Jenner einen Jungen mit Kuhlymphe impfte und dafür ausgelacht wurde, war dieser gegendie Pocken immun. »Daher kommt das Wort ›vaccination‹ für ›Impfung‹: von ›vacca‹ – die Kuh«, verdeutlicht Anna Niederberger dem durchaus erstaunten Publikum.
1874 wurde im Deutschen Reich die Impfpflicht gegen Pocken eingeführt. Nachdem die Weltgesundheitsorganisation WHO im Jahre 1967 für eine weltweite Impfpflicht gegen die Pocken sorgte, konnte sie die Erkrankung 1980 für ausgerottet erklären. Womit die Pocken-Impfpflicht in Deutschland 1982 endete.
Andere Impfungen standen und stehen jedoch nach wie vor auf dem Plan. So erfolgte zwischen 1988 und 2004 in Europa eine 100- bis rund 80-prozentige Senkung der Fallzahlen von impfpräventablen Erkrankungen wie Polio und Diphterie, aber auch beispielsweise Masern oder HIB-Infektionen. Wobei es sich bei letzteren um eine der schwersten und gefährlichsten bakteriellen Infektionen in den ersten fünf Lebensjahren handelt, deren gefürchtetste Komplikation eine eitrige Hirnhautentzündung ist.
Pferde mit im Spiel
Je nach Erreger kann eine Immunisierung passiv oder aktiv erfolgen. Bei einer passiven Schutzimpfung – zum Beispiel gegen Tetanus oder Tollwut – erhält der gefährdete Patient fertige Antikörper. Diese werden von Pferden entnommen, die mit abgeschwächten Erregern geimpft wurden. »Man könnte auch Hühner nehmen«, meint Anna Niederberger, »aber Pferde sind groß und haben viel Blut.« Mit ihrer Hilfe kann daher eine große Menge von Antikörpern gezüchtet werden. Werden diese infizierten Menschen verabreicht, so sorgen sie für einen schnellen, jedoch nur kurz anhaltenden Schutz.
Bei der aktiven Immunisierung hingegen (wie gegen die Grippe) bildet der Patient selbst Antikörper auf abgeschwächte Erreger, die in seinen Körper gebracht werden, oder auf Erreger-Bruchstücke. Das allerdings dauert eine Weile, erst nach sieben bis 14 Tagen besteht voller Schutz. Das heißt, erst dann hat der Mensch genügend Antikörper gebildet, die im Falle einer Infektion die Viren angreifen und deren Vermehrung verhindern.
Wobei die beste Immunantwort auf Lebendimpfstoffe (wie bei z.B. bei Masern, Mumps und Röteln) erfolgt. Die allerdings dürfen im Gegensatz zu Totimpfstoffen (die u.a. bei Tetanus, Keuchhusten und Influenza – der echten Virusgrippe – zum Einsatz kommen) nicht in der Schwangerschaft verabreicht werden. In der Stillzeit hingegen sind prinzipiell alle Impfungen möglich – mit Ausnahme der gegen Tollwut.
Ohne Impfung ist ein Mensch bei Kontakt mit Erregern schutzlos. Ob er erkrankt oder nicht, hängt auch von seiner allgemeinen Abwehrlage ab, sprich von der Robustheit seines täglich von Millionen von Krankheitserregern bombardierten Immunsystems.
»Ihre Impfung schützt andere mit«
»Sein Kind oder sich selbst impfen zu lassen, ist eine persönliche Entscheidung«, betont Anna Niederberger, ohne die Möglichkeit auch schwerer Impfschäden zu verheimlichen. »Wenige Kinder reagieren abnorm«, erläutert sie und verweist unter anderem auf mögliche allergische Reaktionen. »Man muss die generellen Impfreaktionen und Nebenwirkungen kennen und sich eventuell auch über die Zusatzstoffe informieren, um das Risiko abzuschätzen.«
Nicht geimpft werden darf bei Allergie etwa gegen Hühnereiweiß, Antibiotika oder Konservierungsstoffe. Bei akuter Krankheit heißt es, zwei Wochen nach Abklingen der Symptome zu warten. Ebenfalls Tabu ist eine Impfung zwei Wochen vor und nach einer Operation. Und Frühgeborene? Die dürfen erst nach dem errechneten Geburtstermin geimpft werden.
Von all dem abgesehen, verweist die Ärztin auf den sogenannten Herdenschutz. Denn durch die Impfung eines großen Teils der Bevölkerung sinkt auch für Ungeimpfte die Erkrankungswahrscheinlichkeit. Sind dagegen nur wenige Personen geimpft, breitet sich das Virus schnell aus. »Ihre Impfung schützt andere mit«, lautet ein Fazit der engagierten Ärztin.