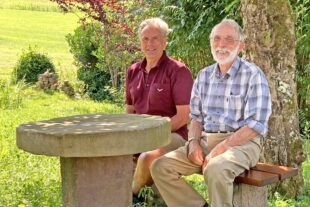»Früher sind bei Waldarbeiten viele Unglücke passiert, wie einige der hiesigen alten Bildstöcke und Wegkreuze bezeugen«, weiß Nordrachs Revierförster Josef Nolle. Und ist als Führungskraft von 35 Forstwirten gottfroh, dass Waldunfälle heutzutage sowohl seltener geschehen als auch glimpflicher verlaufen: »Dies ist auch begründet in den laufenden Fortbildungen der Forstwirte, wie dem Arbeitssicherheitstag der Waldservice Ortenau«.




Und dennoch: Vor wenigen Monaten erst ist einer der besagten Waldarbeiter zwischen zwei gegeneinander rollende Baumstämme geraten und mit dem Fuß nicht mehr rechtzeitig herausgekommen. Nicht ganz jedenfalls: Die zusammenprallenden Stämme erwischten den Mann an der Ferse, bester Ausbildung zum Trotz.
Verletzte Bänder und Stauchungen sind schlimm genug. Ohne professionell verstärktes Sicherheitsschuhwerk jedoch wären die Folgen ungleich übler ausgefallen. Sicherheit? Was heutzutage gerade in diesem Beruf besonders großgeschrieben wird, war noch vor nicht allzu vielen Jahrzehnten ein Fremdwort. Sicherheitskleidung inklusive Helm und Handschuh – das lag in weiter Ferne.
Josef Nolle selbst konnte während seiner 1988 abgeschlossenen Ausbildung zum Forstwirt alte beziehungsweise historische Arbeitsformen in einer praktischen Übung hautnah erleben. »Im Staatswald im Nordracher Hintertal haben wir Bäume per Hand mit der Zweimannsäge und der Axt gefällt.«
Früher: Zweimann – statt Motorsäge
Mit speziellen großen Äxten wurde zunächst die »Fallkerb« herausgeschlagen, »vorne an der Stammbasis.« Diese Kerbe gibt dem Baum die Richtung vor, in die er fallen soll. Um den Baum umzusägen, wurde anschließend die – im Schwarzwald noch teils bis in die 1960er-Jahre gebräuchliche – Zweimannsäge angesetzt.
Wie es der Name nahelegt, bewegten zwei Männer das gezahnte Gerät zwischen sich hin und her. Mit purem Muskeleinsatz natürlich. »Das hat eine gewisse Übung erfordert, um einen gemeinsamen Rhythmus zu finden«, erinnert sich der heute 54-Jährige, der nach seiner dreijährigen Lehre ein Forstwirtschaftsstudium absolvierte.
»Damit der Baum aber nicht nach hinten kippt, wo die Säger stehen, werden in diesen hinteren Teil des Stammes Fällkeile geschlagen und mit der Axt immer wieder nachgetrieben«, erklärt Josef Nolle. Mithilfe besagter Keile kippt der schließlich durchgesägte Baum dann über das Scharnier der Fallkerb – die sogenannte Sehne – in die gewünschte Richtung. Und kracht zu Boden, mit all seinem Gewicht, mit entsprechend respekteinflößendem Getöse.
Ein Segen: Moderne Sicherheitsvorkehrungen
Fallkerb und Fällkeile gehören noch heute zur Technik des Baumfällens, obgleich längst die Motorsäge zum Einsatz kommt. Doch auch die hat ihre Tücken. »Ich denke, dass die Unfallhäufigkeit früher mit Sicherheit höher war, weil man pro Festmeter Holzeinschlag viel mehr Mannstunden hatte«, berichtet der aus der Schwäbischen Alb stammende Wahl-Nordracher von Schnittverletzungen, Stürzen, Sägeverletzungen, Verletzungen durch Axthiebe und einigem mehr. Durch die Einführung der Motorsäge, wohl ab der 1950er Jahre, aber habe zunächst die Schwere der Verletzungen teilweise zugenommen.
Sehr deutlich in der Unfallstatistik wirkte sich dann die Verbesserung der Motorsäge in punkto Sicherheit aus, wie zum Beispiel die Einführung der Ketten- beziehungsweise Rückschlagbremse. Doch selbst wenn Fehlerschwere und -heftigkeit durch Sicherheitseinrichtungen deutlich zurückgegangen seien, gehöre der Beruf des Holzfällers noch immer zu einem der gefährlichsten, gemeinsam mit dem des Dachdeckers und Gerüstbauers, betont Josef Nolle: »Ich kenne einen jungen Forstwirt, der hat die Motorsäge durch einen Rückschlag ins Gesicht gekriegt.« Überdies gebe es immer wieder Stürze – wie in dem zwar idyllischen aber eben auch steilen und entsprechend schwierigen Bergwaldgelände rund um Nordrach.
Abseilen per Hand
Mit dem »Umsägen« eines Baumes ist die Arbeit noch lange nicht getan. Denn die vielen hölzernen Meter müssen entastet und aus dem Wald ins Tal transportiert werden. Wie das zu früheren Zeiten erfolgte, weiß der Revierförster ebenfalls.
»Ich selbst habe Bäume noch lange mit der Axt entastet. In meiner Ausbildung wurde die Motorsäge nur zum Fällen und Entasten von mittelstarkem und Starkholz verwendet, aber Schwachholz haben wir von Hand entastet.« War man gut genug, ging das so schnell wie mit der Motorsäge, »in zehn Minuten hat man die Äste weggehabt.«
Im Vergleich zum Arbeiten mit der schweren Motorsäge beschreibt der Revierförster das Hantieren mit der Axt als bewegungsintensiver und daher angenehmer. Gefahrenintensiv und belastend für den Organismus jedoch waren beide Verfahren. Weswegen ein Stamm heutzutage maschinell gesäubert wird – von einem »Astbock«, passenderweise auch »Ast-Ab-Gerät« genannt.
Wie nun aber den gefällten und von seinem sperrigen Geäst befreiten Stamm aus dem steilen Gelände transportieren? »Abseilen« lautete dereinst die Lösung. Was bedeutete, dass Baumstämme in unwegigen Hanglagen mittels Seilen abgelassen wurden. Per Hand wohlgemerkt.
Auch dies ein unfallträchtiges Unterfangen. Umso mehr, als früher hauptsächlich im Winter »Holz gemacht wurde«, selbst im Schnee – weil die Bauern ob dann nicht anstehender Feldarbeit Zeit dazu hatten, das Holz trockener und der Boden gefroren und somit fest war.
Holzernte inzwischen ganzjährig
Heutzutage jedoch wird fast das ganze Jahr über Holz geerntet, werden Bestände gepflegt. Bis auf eine wachstumsbedingte Pause im Sommer sowie witterungsbedingte Unterbrechungen. Schließlich gilt es, fest angestelltes Waldpersonal ebenso auszulasten wie moderne Maschinen – Rückeschlepper beispielsweise. Ein solcher holt heutzutage die entasteten Stämme aus dem Nordracher Wald.
Mit etwa 12 Tonnen ist das Gerät schwerer als das Holz, das es zieht, und damit standsicher. Ohne jedoch einen zu großen Bodendruck auf den Waldwegen auszuüben, dank breiter Reifen. Und auch sonst ist die Maschine auf Umweltfreundlichkeit ausgelegt – ob eines getrennten Schmierkreislaufs für Getriebe- und Hydrauliköl. Denn nur letzteres ist biologisch abbaubar und verursacht bei einem möglichen Austritt – wenn sich etwa ein Ast in den Hydraulikschlauch einhängt – keine Schäden im Wald.
Das Arbeiten in diesem für den Menschen so wichtigen Ökosystem empfindet Josef Nolle als ein im positiven Sinne besonderes. »Nur wenn ich im Wald bin, geht’s mir gut.«
Handwerk
Die Aufgabe des Holzfällers liegt im Fällen von Bäumen und deren Vorbereitung zum Abtransport. Bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts arbeitete er eng mit den heute fast ausgestorbenen Berufen der Flößer und Köhler zusammen.
Der bis in die Antike zurückreichende Beruf des einfachen Holzfällers hat sich heutzutage zum Forstwirt und spezialisierten Maschinenbediener gewandelt.



![René Rosenberger erhält die UEFA Grassroots C-Lizenz 2025-4-15-NO-Verein-ASV-René Rosenberger-IMG_6424[58]](https://www.schwarzwaelder-post.de/wp-content/uploads/2025/04/2025-4-15-NO-Verein-ASV-Rene-Rosenberger-IMG_642458-310x207.jpg)