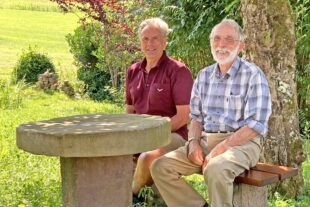Die Gemarkung besteht zu rund 80 Prozent aus Wald. »Wegen der Hitze und Trockenheit auch in diesem Sommer haben auch wir natürlich ein Käfer- und Dürreproblem«, resümiert Nordrachs Förster Josef Nolle im Vorfeld zu einer Waldbegehung mit dem Gemeinderat. Der Waldexperte berichtet von den Waldschäden der Berg- und Talgemeinde und erklärt Gegenmaßnahmen in einem Gebiet, das 255 bis 878 Höhenmeter abdeckt.
»Wir haben einen Käferbefall vor allem in der Fichte und die Tanne fällt alleine schon aufgrund der Trockenheit sehr häufig aus, wird also braun«, resümiert Förster Josef Nolle – wie allüberall »tun sich auch in Nordrach Fichte und Tanne in unserem Klima im Moment ein wenig schwer.«
Und doch sei die Tanne wegen ihres tiefer in den Boden reichenden Wurzelwerks auf jeden Fall klimastabiler als Deutschlands häufigste Baumart, die wuchskräftige und vielseitig verwendbare Fichte. »Klimastabiler zumindest in Nordrach«, betont der 52-Jährige. Er ist nicht nur für den kommunalen und den Privatwald in dem auf 255 bis 878 Höhenmetern liegenden Gemeindegebiet zuständig, sondern zeitgleich im Forstbezirk Offenburg als Revierleiter im Bereich Vorderes Kinzigtal tätig. Daher weiß er: »Wenn ich in Gengenbach tagsüber eine Temperatur von 35 oder 37 Grad habe, dann ist es in Nordrach immer zwei Grad kühler.«
Mit dem Ergebnis, dass vom Rheintal aus bis nach Biberach die Trockenheit intensiver ist als »hinten in Nordrach: Sobald man in den Berg kommt, wird es mit der Trockenheit ein bisschen besser.« Josef Nolle betont »bisschen«. Denn die in diesem Jahr aufgetretenen Schäden an der Tanne gehen allesamt eben auf sie zurück: die Trockenheit des vergangenen Sommers. »Auch wir haben mit einer Dürre im Boden schon bei unter Umständen 25 bis 30 Zentimetern zu kämpfen.« Daran ändert auch der Regen der letzten Tage nicht viel.
Wobei der Fachmann davon ausgeht, dass junge Tannen sich vielleicht an diese Gegebenheiten gewöhnen können. Denn selbst in so trockenen Gegenden wie Süditalien und in den Südpyrenäen wächst diese Baumart, »aber die alten Bäume in unseren Wäldern, die packen die Umstellung auf den Klimawandel nicht mehr.«
Dazu erklärt Josef Nolle, was in den unteren Bodenschichten durch die Trockenheit passiert: Der Boden schrumpft zusammen, Risse entstehen. Die Feinwurzeln der Tanne halten diese Spannung nicht aus und reißen teilweise ab. Was bedeutet, dass der Baum einen Teil jener Feinwurzelmasse verliert, die ihn mit Wasser und Nährstoffen versorgt.
Douglasie und Co.
Mit den beiden Nadelbaumarten Hybridlärche und Douglasie sind nun daher Kahlflächen aufgeforstet worden – die waren in den letzten zwei Jahren dort entstanden, wo von Käfern befallenes Holz geschlagen werden musste.
»Nicht, dass die Douglasie gar keine Probleme hätte«, betont der Waldexperte, »aber sie ist deutlich trockenheits- und käferresistenter als Fichte oder Tanne.«
Das natürliche Verbreitungsgebiet dieses fremdländischen Nadelbaumes liegt im Westen Nordamerikas.
Sowohl in Deutschland als auch in Europa ist die Douglasie die am meisten angebaute fremdländische Baumart, wegen ihrer hohen Stabilität in Verbindung mit geringer Anfälligkeit gegenüber Krankheiten und Schädlingen. Zudem ist ihre Wuchsleistung bis zu 50 Prozent höher als bei Tanne oder Fichte. Bis zu 60 Meter hoch wird sie, und bis zu 400 Jahre alt.
Und was die Hybridlärche betrifft: »Sie ist ein Hybrid von der Europäischen zur Japanerlärche, sie vereint praktisch die guten Eigenschaften der beiden Lärchenarten«, erläutert Josef Nolle: »Damit versuchen wir eine Mischung reinzukriegen, dass wir nicht nur Douglasie anbauen.«
Überdies ist der Hybrid nicht vermehrungsfähig, so dass sich der Baum nicht invasiv verbreiten kann. »Man muss also keine Angst haben vor Faunaverfälschung«, weiß der versierte Fachmann nur zu gut um die Sorgen von Naturschutzverbänden in Bezug auf den Anbau fremdländischer Baumarten, die klimaresistenter sind als unsere Fichten und Tannen. Klimaresistenter deshalb, weil sie in klimatischen Verhältnissen vorkommen, die nicht unser langjähriges Klima in der Vergangenheit repräsentieren, sondern das bei uns zu erwartende.
Durchmischung
Wichtig ist zudem eine Erhöhung des Laubbaumanteils. Denn gemischte Wälder sind in punkto Stürme, Käferbefall und Dürre wesentlich weniger anfällig als Monokulturen. Und so kommt Josef Nolle auf die Buche zu sprechen. Die Ausfälle seien in Nordrach zwar nicht so massiv wie andernorts, »aber auch wir haben Buchen, die kaputtgehen, teils großflächig – es gibt ein paar Stellen, wo man sie wegmachen muss.«
Buchen und Roteichen aus Serbien beispielsweise seien eine Alternative. Hierbei handelt es sich genetisch um den jeweils gleichen Baum, jedoch um einen anderen Phenotyp: Der hat sich an schwierige Klimaverhältnisse angepasst, weil er in ihnen aufgewachsen ist. »Ich könnte auch Buche aus Apulien, den Apeninnen oder aus Sizilien nehmen. Und Tanne aus den Pyrenäen«, unterstreicht der Förster, »ob die es dann definitiv hier aushält oder nicht – das wird man erst sehen.«
Auch der Anbau der Atlas- und Libanonzeder sei denkbar. Überdies empfiehlt er für den kommunalen wie auch den Privatwald in Nordrach die Baumhasel, zumindest an Grenzstandorten. Der große Verwandte unserer Haselnusssträucher, wegen seines wertvollen »Rosenholzes« für den Möbelbau der Biedermeierzeit hierzulande dereinst nahezu ausgerottet, ist »relativ duldsam gegenüber schlechten Einflüssen.« Seit vielen Jahren bereits wird die Baumhasel daher in städtischen Bereichen eingesetzt.